
Afrodeutsche in der Weimarer Republik
Schon vor 100 Jahren lebten in Deutschland nicht wenige Schwarze¹ Menschen. Viele organisierten sich für ihre Rechte und gegen Kolonialismus
Mit Beginn der Kolonialzeit kamen zunehmend mehr Schwarze Menschen aus Afrika nach Deutschland. Landesweit organisierten sie sich erstmals in der Weimarer Republik. Mit dem „Afrikanischen Hilfsverein“ unterstützten sie sich bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche. Doch von Beginn an hatte der Verein auch politische Ziele. Ein Kampf gegen Ausgrenzung und Rassismus begann, der bis heute anhält.
„Wir verlangen, da wir Deutsche sind, eine Gleichstellung mit denselben, denn im öffentlichen Verkehr werden wir stets als Ausländer bezeichnet. Dieses muß von der jetzigen Regierung durch öffentliche Bekanntmachung beseitigt werden.“ Diese Forderung ist Teil einer 32 Punkte umfassenden Eingabe, mit der sich eine Gruppe einstiger Kolonialmigranten aus den damaligen deutschen Kolonialgebieten Kamerun und Deutsch-Ostafrika (heute Tansania und Teile von Ruanda und Burundi) im Juni 1919 an die Nationalversammlung im Weimar wandte. Sie waren zu Ausbildungszwecken, als Teilnehmer von Völkerschauen, als Seeleute, im Dienst von Kolonialherren oder auch um ihre Muttersprachen an deutschen Kolonialinstituten zu lehren ins Kaiserreich gekommen.
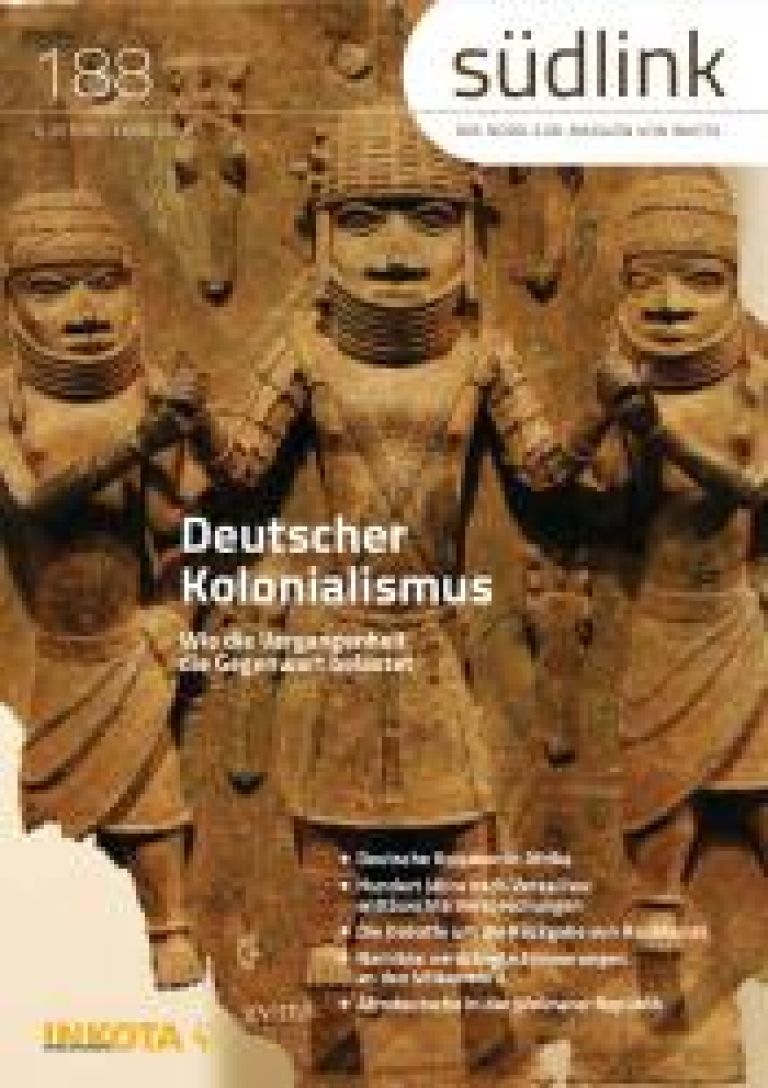
Eingereicht wurde die Eingabe, besser bekannt als Dibobe-Petition, von Martin Dibobe, der 1896 als Teilnehmer der ersten Deutschen Kolonialausstellung im Treptower Park aus Kamerun in die deutsche Hauptstadt gekommen war. Inzwischen arbeitete er bei der U-Bahn und war mit einer gebürtigen Berlinerin verheiratet, mit der er zwei Kinder hatte. Der Zeitpunkt der Eingabe war strategisch günstig, denn vor Abschluss der Friedensverträge mit den Alliierten hoffte Deutschland noch darauf Kolonialmacht bleiben zu dürfen und bat die einstigen Kolonialmigranten um Fürsprache gegenüber den Siegermächten.
Dibobe und seine Mitstreiter knüpften ihre Zustimmung zu einem Verbleib ihrer Herkunftsländer unter deutscher Herrschaft daraufhin an eine Gleichstellung von Afrikaner*innen in den Kolonialgebieten und in Deutschland. Sie forderten gleiche Gesetze für alle, die Abschaffung von Prügelstrafen und Zwangsarbeit, Lohngleichheit, gleichen Zugang zu Bildung sowie die Einführung eines „ständigen Vertreter(s) unserer Rasse im Reichstag oder in der Nationalversammlung“. Ihre Bemühungen blieben letztlich erfolglos, doch die politische Selbstorganisation und Intervention von Afrikanern in der Weimarer Republik ging weiter, wurde radikaler und bald dezidiert antikolonial.
Mehr als eine Selbsthilfeorganisation
Der Dibobe-Petition ging die Gründung des Afrikanischen Hilfsvereins (AH) am 1. Mai 1918 in Hamburg voraus. Getragen wurde der Verein von einstigen Kolonialmigranten, es gab aber auch Mitglieder aus Marokko, Liberia, Ghana und den USA. Bemerkenswert ist zudem, dass die Mitglieder keineswegs alle in Hamburg wohnten, wo der Verein gegründet wurde. Viele lebten in Berlin, einige aber auch in Köln, Herne, im bayrischen Dülmen, im westpreußischen Zoppot und im niederschlesischen Breslau.
Es gab bereits damals eine gut vernetzte Schwarze Community, und die Familiengeschichten der Gründungsmitglieder des AH, die sich bis heute fortschreiben, zeugen von der beträchtlichen Anwesenheit Schwarzer Menschen in Deutschland seit über 100 Jahren. So leben der Sohn von Theophilius Wonja Michael, der das NS-Regime überlebte, mit seinen Kindern und Kindeskindern und die Enkelin von Najo Bruce, der als Schausteller gearbeitet hatte, heute in Köln. Die Familie Diek lebt bereits in fünfter Generation in Deutschland.
Offiziell war der AH eine reine Selbsthilfeorganisation, die bei lebenspraktischen Dingen wie der Arbeits- und Wohnungssuche helfen und dem „Gefühl der Vereinsamung inmitten der weißen Bevölkerung“ entgegenwirken sollte. Im Gründungsstatut heißt es ausdrücklich, dass sich der Verein mit politischen Angelegenheiten in keiner Weise befassen solle. Diese Formulierung ist jedoch vor allem ein notwendiges Zugeständnis an die Behörden, die Vereine von Ausländer*innen und Kolonialisierten auflösen konnten, selbst wenn diese oder deren Mitglieder nicht gegen Gesetze verstießen. Es reichte, wenn ein Verein „unliebsame Ziele“ verfolgte. Die Dibobe-Petition steht möglicherweise auch deshalb nicht in direktem Zusammenhang mit dem AH, wenngleich viele der Vereinsmitglieder die Petition unterzeichneten.
Der Afrikanische Hilfsverein war in seiner Funktion als „Rundumhilfe“ aber dennoch von Anfang an politisch. Denn unter den Bedingungen des damals herrschenden strukturellen Rassismus, der sich auch im diskriminierenden Aufenthaltsrecht sowie im rassistisch segregierten Arbeits- und Wohnungsmarkt niederschlug, waren Praktiken zur Kollektivierung von Bewältigungsstrategien struktureller Gewalt äußerst politisch. Diese wurden in der Weimarer Republik besonders wichtig.
Abonnieren Sie den Südlink
Im Südlink können Autor*innen aus dem globalen Süden ihre Perspektiven in aktuelle Debatten einbringen. Stärken Sie ihnen den Rücken mit Ihrem Abo: 4 Ausgaben für nur 16 Euro!
Denn wenngleich Rassismus, als elementarer Bestandteil und Legitimationsgrundlage von Kolonialherrschaft, bereits zuvor die Lebensbedingungen Schwarzer Menschen in Deutschland prägte, verschärften sich offen rassistische Anfeindungen und Diskriminierungen nach dem Verlust der Kolonien erheblich. Viele verloren deswegen ihre Jobs, und es gab für sie kaum noch Möglichkeiten ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Auch der rechtliche Status der einstigen Kolonialmigranten verschlechterte sich dramatisch. Sie erhielten einen Stempel mit dem Vermerk „ehemaliger Schutzgebietsangehöriger“ oder „ehemaliger Schutzbefohlener“ in den Pass und wurden damit praktisch staatenlos.
Nur wenige wurden eingebürgert
Theoretisch sollten sie Angehörige der neuen Kolonialmächte Großbritannien oder Frankreich werden und in ihre Herkunftsregionen zurückkehren. Doch viele blieben trotz prekärer Lage und mangelnder Perspektive in der Weimarer Republik. Manche konnten die Rückreise nicht finanzieren. Vielen verwehrten die neuen Kolonialmächte aber auch die Einreise, weil sie pro-deutsche Propaganda befürchteten, oder weil sie ihre Weißen deutschen Frauen und die gemeinsamen Kinder mitnehmen wollten.
Einige wenige wurden in der Weimarer Republik eingebürgert und bekamen damit einen gesicherteren Status. Die Einbürgerung war reine Ermessenssache und konnte ohne Angabe von Gründen versagt werden, selbst wenn die Antragssteller den größten Teil ihres Lebens in Deutschland verbracht hatten. Auch für Anumu, den ersten Vorsitzenden des Afrikanischen Hilfsvereins, war diese Willkür sehr belastend. 1917 bemühte er sich um seine Einbürgerung in Deutschland.
Zu diesem Zweck bat er Adolph Friedrich von Mecklenburg-Schwerin, den letzten deutschen Gouverneur von Togo, mit folgenden Worten um Unterstützung: „Da ich als Eingeborener [Togos] hier in Deutschland nicht [heimatsberechtigt] bin, trotzdem ich schon seit meinem siebten Lebensjahre mich hier befinde, hier getauft, erzogen und konfirmiert bin und jetzt hier selbstständig ein Geschäft betreibe, so habe ich den Wunsch, hier in Deutschland, in Hamburg, das Heimatsrecht zu erhalten und bitte hierdurch ergebenst um Eurer Hoheit gütige Förderung dieser Angelegenheit.“2 Doch obwohl Adolph Friedrich zu Mecklenburg-Schwerin Anumus Einbürgerung befürwortete, wurde diese abgelehnt.
Über den AH hinaus waren einige Vereinsmitglieder auch in anderen Kontexten politisch aktiv und nahmen dabei weitaus radikalere Positionen ein. Den Anfang machte Mdachi bin Sharifu, der aus Ostafrika ins Kaiserreich kam, mehrere Jahre am Seminar für Orientalische Sprachen an der Königlichen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Berlin als Swahili-Lehrer tätig war und die Dibobe-Petition ebenfalls unterzeichnet hatte.
Im Sommer 1919, kurz nach Deutschlands endgültigem Verlust seiner Kolonien, trat bin Sharifu in mehreren Städten als Redner über „Unsere koloniale Vergangenheit“ auf und ging dabei sowohl mit dem deutschen Kolonialregime als auch mit dem anhaltenden Kolonialrassismus in Deutschland öffentlich ins Gericht. Unterstützt wurde er bei seinen Auftritten von einigen Sozialdemokraten sowie von dem der USPD nahestehenden Pazifisten Hans Paasche. In Berlin, Erfurt und Hamburg ergriff zum ersten Mal überhaupt ein Schwarzer zu diesen Themen das Wort. Seine Auftritte riefen dementsprechend heftige Reaktionen im Weißen Publikum hervor.
Während bin Sharifu bald darauf in seine Heimat, das heutige Tansania, zurückkehrte, wo sich seine Spur verliert, radikalisierten sich andere, wie zum Beispiel Joseph Bilé, im Kontext der Kommunistischen Internationale (Komintern). Von dem Bündnis mit der Sowjetunion versprachen sich viele Kolonialisierte eine große Chance auf Unabhängigkeit. Bilé, der einst aus Kamerun nach Deutschland gekommen war, nahm sowohl 1929 in Berlin an der Gründung der „Liga zur Verteidigung der N*rasse“ (LzVN) als auch ein Jahr später an der Gründung des „International Trade Union Commitee of Negro Workers“ (ITUCNW) in Hamburg teil. Beide Organisationen waren offiziell politisch, antikolonial und antiimperial und agierten in einem weitreichenden internationalen Netzwerk, das aus Aktivisten und auch Aktivistinnen in Europa, den USA, Westafrika, Kenia, Südafrika und der Karibik bestand. In den 1930er Jahren trat auch Bilé regelmäßig als politischer Redner auf, um seine Zuhörer über die Brutalität des deutschen Kolonialregimes und die Gewalt, unter der Afrikaner*innen weltweit litten, aufzuklären.
Mit der Machtergreifung Hitlers nahm der politische Aktivismus Schwarzer Menschen in Deutschland ein jähes Ende. Wer konnte, ging nach Paris, London oder zurück in seine Herkunftsregion auf dem afrikanischen Kontinent. Die einzige Überlebensstrategie im nationalsozialistischen Deutschland war die des „Nichtauffallens“, wie es Theodor Michael in seiner Autobiographie „Deutsch sein und schwarz dazu“ schildert. Wie viele ihren Tod in KZs fanden, ist bisher nicht aufgearbeitet worden. Zur formellen Selbstorganisation Schwarzer Menschen in Deutschland kam es erst wieder in den 1980er Jahren, wobei die Aufarbeitung der afro-deutschen Geschichte eine zentrale Rolle spielte.
1Um die Wörter „schwarz“ und „weiß“ nicht als Eigenschaft, sondern als konstruierte Zuschreibung zu charakterisieren, werden sie groß geschrieben.
2Einbürgerungsakte Anumu, Staatsarchiv Hamburg, 332-7/B VI 1154.
Zur Autorin
Bebero Lehmann ist Historikerin und Journalistin. Sie bietet (post)koloniale Stadtrundgänge durch Köln an, engagiert sich in der bundesweiten Initiative „Decolonize Deutschland“ und hat den ersten Black History Month in Köln initiiert, der im Februar 2019 stattfand.
Bebero Lehmann ist Historikerin und Journalistin. Sie bietet (post)koloniale Stadtrundgänge durch Köln an, engagiert sich in der bundesweiten Initiative „Decolonize Deutschland“ und hat den ersten Black History Month in Köln initiiert, der im Februar 2019 stattfand.







