
„Boden darf keine Ware sein“
Interview mit der kolumbianischen Agraraktivistin Nury Martínez über Landreformen und die soziale Funktion des Bodens
Kleinbäuerliche Organisationen setzen sich mit dem weltweiten Netzwerk La Via Campesina für Ernährungssouveränität und die Umverteilung von Land ein. In der internationalen Debatte hat das Thema Agrarreformen seit Jahren einen schweren Stand. Die im kommenden Jahr in Kolumbien geplante Internationale Konferenz über Agrarreform und ländliche Entwicklung (ICARRD+20) könnte das Thema wieder auf die Tagesordnung bringen. Im Südlink-Interview erklärt die Gewerkschafterin Nury Martínez, welche Erwartungen mit der Konferenz verknüpft sind und wie es um die Agrarreform in Kolumbien steht.
Die Forderung nach Agrarreformen erscheint heute vielen als anachronistisch. Warum ist das Thema noch von Bedeutung?
Agrarreformen sind mehr denn je notwendig. Boden ist ein unabdingbares öffentliches Gut, um Lebensmittel zu produzieren, die Biodiversität zu erhalten und Ökosysteme zu schützen. Doch er ist immer mehr durch Land Grabbing bedroht. Die Folge ist eine Zunahme des Hungers.
In den vergangenen Jahrzehnten gab es in zahlreichen Ländern Agrarreformen. Häufig haben sie zumindest vorübergehend Land umverteilt und den kleinbäuerlichen Sektor gegenüber Großgrundbesitzern gestärkt. Die Armut auf dem Land konnte jedoch meist nicht nachhaltig überwunden werden. Woran liegt das?
Von den bisherigen Agrarreformen haben nicht zwangsläufig immer Kleinbäuerinnen und Kleinbauern (campesinos) profitiert, sondern häufig auch das Agrobusiness, das sich über diese Prozesse modernisieren konnte. Dabei ernährt der kleinbäuerliche Sektor weltweit die meisten Menschen, und zwar mit relativ wenig Fläche. Die größeren Landbesitzer hingegen lassen Boden brachliegen, nutzen ihn für industriellen Anbau in Monokulturen, für Agrotreibstoffe oder extensive Viehhaltung. Sie tragen also wenig zu einer diversifizierten Ernährung bei. Um die Armut auf dem Land zu überwinden, reicht es aber nicht aus, nur den Boden umzuverteilen. Wir brauchen demokratische, integrale Agrarreformen.
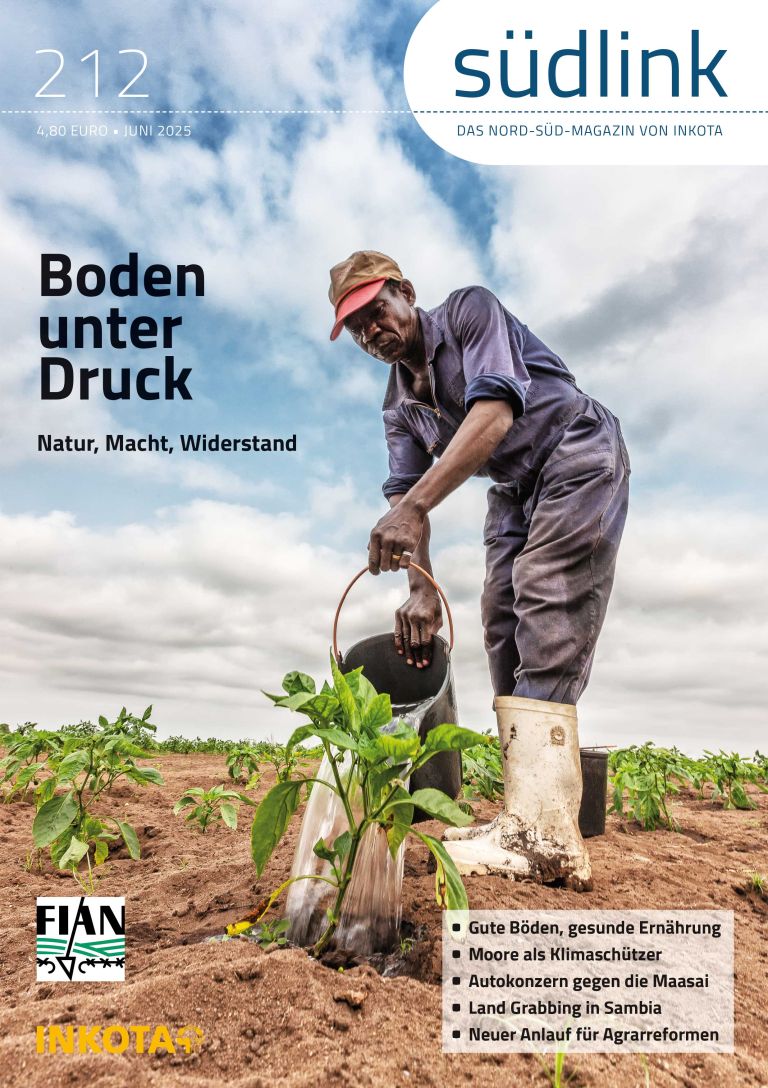
Was umfasst dies?
Die Armut auf dem Land hat vor allem damit zu tun, dass nicht in Bereiche wie Gesundheit, Bildung oder Infrastruktur investiert wird. Auch sind die Marktbedingungen ungerecht für kleine Produzent*innen, die oft zu sehr niedrigen Preisen an Zwischenhändler*innen verkaufen müssen. Die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern verdienen so wenig, dass sie manchmal kaum die Kosten für Saatgut und Anbau decken können.
Es geht also nicht nur um den Zugang zu Land, sondern auch zu Wasser, Saatgut, Krediten und technischer Unterstützung. Zudem sollten die Regierungen weltweit kleinbäuerliche Märkte unterstützen und Produkte öffentlich aufkaufen. Eine integrale Landreform betrifft die gesamte Gesellschaft und ist auch im Sinne der städtischen Bevölkerung. Die Debatte über die soziale Funktion des Bodens ist daher immens wichtig.
Was genau ist mit der sozialen Funktion des Bodens gemeint?
Es geht darum, Böden für die Produktion von Lebensmitteln zu verwenden, sodass sie der lokalen Gemeinschaft und gesamten Gesellschaft nutzen. Wenn Großgrundbesitz brachliegt oder für extensive Viehhaltung mit sehr wenigen Tieren genutzt wird, erfüllt der Boden diese soziale Funktion nicht, sondern ist schlicht unproduktiv. Das Land sollte jenen zugutekommen, die es bearbeiten.
Ja, ich mach mit!
Setzen Sie sich dauerhaft mit uns für eine gerechte Welt ohne Hunger und Armut ein und werden Sie INKOTA-Fördermitglied! Als Mitglied erhalten Sie zudem viermal im Jahr unser Magazin Südlink druckfrisch nach Hause.
Ich bin dabei!Kolumbien ist Anfang 2026 Gastgeberland der zweiten Internationalen Konferenz über Agrarreform und ländliche Entwicklung (ICARRD+20). Die Vorgängerkonferenz fand 2006 im brasilianischen Porto Alegre statt. Welche Bedeutung hatte diese?
Die Konferenz in Porto Alegre suchte vor allem nach Wegen, den weltweiten Hunger zu bekämpfen. In der Folge verabschiedete der Welternährungsausschuss der Vereinten Nationen (CFS) im Jahr 2012 die „Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Verwaltung von Boden- und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäldern“. Diese gehen direkt auf kleinbäuerliche Forderungen zurück und stehen für die Umsetzung des Rechts auf Nahrung.
Welche Bedeutung haben die Leitlinien in der Praxis?
Sie sind nicht bindend, ihre Verabschiedung war dennoch ein Fortschritt. Die Leitlinien wurden in einem breiten Prozess erarbeitet, müssen aber von den jeweiligen Regierungen implementiert und umgesetzt werden. In einigen Ländern ist es gelungen, mit Bezug auf die Leitlinien weitgehende öffentliche Politiken gegenüber dem kleinbäuerlichen Sektor zu etablieren, zum Beispiel in den Bereichen Umweltschutz oder kollektive Landtitel.
Ein Problem der Leitlinien ist, dass sie sehr technisch formuliert sind. Von La Via Campesina aus haben wir daher ein Handbuch entwickelt, das die Inhalte verständlich aufbereitet, damit kleinbäuerliche Bewegungen sich effektiv auf sie beziehen können. Dies hat in einigen Ländern, darunter Kolumbien, zur besseren Verbreitung der Inhalte beigetragen.
Was erwarten sie von der Konferenz ICARRD+20, die im Februar kommenden Jahres im kolumbianischen Cartagena stattfinden soll?
Wir hoffen, dass die Konferenz an die erste von 2006 anknüpft, bewertet, was seitdem geschehen ist, und ein Zeichen für die Umverteilung von Land sowie den Schutz der Biodiversität setzt. Auch hoffen wir auf eine breite Beteiligung sozialer Bewegungen und Sichtbarkeit für kleinbäuerliche und indigene Akteure sowie internationale Verbündete aus dem städtischen Raum.
Dieses Jahr im September findet in Sri Lanka bereits das Globale Nyéléni-Forum als Treffen der Bewegungen für Ernährungssouveränität statt, aus dem wichtige Impulse hervorgehen können. Eine Herausforderung besteht darin, uns als kleinbäuerliche Bewegungen besser zu vernetzen, um die Debatte um eine soziale Funktion des Bodens stärker führen zu können und die Regierungen auf der Konferenz zum Handeln zu bewegen. Böden und Natur dürfen keine Waren sein.
Abonnieren Sie den Südlink
Im Südlink können Autor*innen aus dem Globalen Süden ihre Perspektiven in aktuelle Debatten einbringen. Stärken Sie ihnen den Rücken mit Ihrem Abo: 4 Ausgaben für nur 18 Euro!
Als eine von wenigen Regierungen weltweit führt die kolumbianische unter dem Mitte-Links-Präsidenten Gustavo Petro derzeit eine Agrarreform durch. Im gewalttätigen Kontext Kolumbiens ist dies nicht einfach. Wie steht es um die Agrarreform?
Der politische Kontext ist tatsächlich schwierig. Der Kongress unterstützt den sozialen Reformkurs der Regierung nicht und das betrifft auch die Agrarreform. Zwar gibt es auch Fortschritte. So hat der Kongress Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 2024 offiziell als Rechtssubjekte anerkannt. Viele Gesetze benachteiligen aber nach wie vor den kleinbäuerlichen Sektor.
Die Regierung versucht, die Agrarreform auf Grundlage der neoliberalen Gesetzgebung aus den 1990er Jahren umzusetzen, die zum Ziel hatte, einen Markt für Landtitel zu schaffen. Die Gesetzgebung enthält aber auch fortschrittliche Elemente wie die Möglichkeit, Kleinbäuerliche Schutzzonen (ZRC) einzurichten, in denen der Markt keine Rolle spielt. Zudem ist das Thema mit dem ersten Kapitel des Friedensvertrages zwischen dem Staat und der ehemaligen Guerilla Farc von 2016 verbunden. Dieses sieht als Zielsetzung vor, eine integrale Agrarreform durchzuführen und dafür auch Land umzuverteilen.
Wie geht die Regierung von Präsident Gustavo Petro bei der Umverteilung von Land konkret vor?
Die Regierung versucht seit 2022, große Landbesitzer davon zu überzeugen, freiwillig Land zu verkaufen. Dieses soll dann an Kleinbäuerinnen und Kleinbauern verteilt werden. In der Praxis geht dieser Prozess aber nur sehr langsam voran. Das meiste Land, das die Regierung bisher verteilt hat, stammt aus ehemals von Paramilitärs besetzen Gebieten, die es sich häufig gewaltsam angeeignet hatten. Der Staat konnte diese Gebiete zurückgewinnen, das heißt, der Kontrolle der Paramilitärs entreißen.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Formalisierung von Landtiteln und die Rückgabe geraubten Landes. In einem Land wie Kolumbien, das im Rahmen bewaffneter Konflikte jahrzehntelang Vertreibungen und die erzwungene Umverteilung von Land erlebt hat, ist das sehr komplex. Aber alleine schon, dass eine Debatte über die soziale Funktion des Bodens offen geführt wird, ist enorm wichtig. Das hat es in den 200 Jahren der Republik bislang nicht gegeben.
Vor welchen Herausforderungen steht in diesem Zusammenhang die kleinbäuerliche Bewegung in Kolumbien?
Als kleinbäuerliche Bewegung vernetzten wir uns immer besser und blicken auf längere Zeiträume jenseits der aktuellen Regierung, um die Agrarreform umzusetzen. Es geht darum, dass die Agrarreform eine Politik des Staates und nicht nur einer Regierung wird. Dafür vernetzen wir uns mit weiteren Akteuren, etwa an Universitäten, mit urbanen Bewegungen sowohl in Kolumbien als auch in anderen Ländern. Denn die Agrarpolitik hat auch eine internationale Dimension und muss daher ebenso auf dieser Ebene angegangen werden.
Das Interview führte Tobias Lambert. Nury Martínez ist Vorsitzende der Nationalen Landwirtschaftsgewerkschaft FENSUAGRO in Kolumbien und Mitglied der Lateinamerikanischen Koordination ländlicher Organisationen (CLOC-Via Campesina).



