
Der Philosoph aus Axim
Warum Anton Wilhelm Amo für die Schwarze Geschichte in Deutschland so wichtig ist. Und warum eine Straßenumbenennung ein wichtiges Zeichen der Zugehörigkeit sein kann
Nach einem langen Kampf um die Umbenennung einer Straße haben dekoloniale Initiativen und Akteur*innen in Berlin im August einen großen Erfolg errungen. Anton Wilhelm Amo, der erste bekannte Gelehrte afrikanischer Herkunft in Deutschland, löst einen mehr als 300 Jahre alten rassistischen Straßennamen ab. So ersetzt Selbstbestimmung Fremdbezeichnung, und während manche Gegner*innen noch empört wettern, gilt es nun, Anton Wilhelm Amo den ihm gebührenden Raum zu geben und in Deutschland an ihn zu erinnern.
Das Thema ist nicht neu in Berlin. Seit den 1980er und 1990er Jahren fordern Aktivist*innen die Umbenennung von Straßen, die ehemalige Kolonialisten ehren oder rassistische Namen tragen. Seit etwa fünfzehn Jahren setzen sich verschiedene zivilgesellschaftliche Initiativen, wie das Bündnis Decolonize Berlin für Straßenumbenennungen ein.
Dass darüber gestritten werden muss, dass keine Menschen geehrt werden sollen, die für den Tod, die Ausbeutung, Versklavung und Herabwürdigung anderer Menschen verantwortlich sind, übersteigt das Verständnis vieler. Immer wieder werden angebliche Traditionen und ein vermeintlich gefährdetes Kulturerbe über die Würde der Menschen gestellt, in deren Lebenswirklichkeit sich die weniger idyllische Kehrseite deutscher Geschichte widerspiegelt. Der Prozess ist langwierig, aber mehrere neue Straßennamen im Afrikanischen Viertel in Berlin-Wedding oder das May-Ayim-Ufer in Kreuzberg sind erste und wichtige Erfolge. Eine Straße sticht in diesen Kämpfen besonders hervor: die M*-Straße in Berlin-Mitte, deren Namen Schwarze Aktivist*innen wie etwa die 1996 verstorbene May Ayim schon in den 1990er Jahren kritisiert hatten.
Die rassistische Fremdbezeichnung M*1, nach der 1706 eine Straße im Zentrum Berlins und erst 1991 auch eine dort angrenzende U-Bahn-Station benannt wurden, ist eine Herabwürdigung Schwarzer Menschen beziehungsweise Menschen afrikanischer Herkunft. Sie symbolisiert nicht nur eine gewaltvolle und rassistische Geschichte, sondern auch die fehlende Auseinandersetzung mit historischer Verantwortung und respektvoller Erinnerungskultur. Zum Glück hatten all jene, die sich wie Decolonize Berlin oder Black Lives Matter Berlin für die Umbenennung des rassistischen Straßennamens einsetzten, einen langen Atem: Nach sechs Umbenennungsfesten und mehreren Demonstrationen, die an der M*Straße ihren Auftakt nahmen, gab es dieses Jahr Grund zum Feiern. Dabei sah es lange Zeit gar nicht danach aus. Trotz Jahren an Offenen Briefen, Interviews, Aktionen und anstrengenden Gesprächen mit Politiker*innen und anderen Akteur*innen ging es auch in diesem Jahr wieder an die Planung des Straßenumbenennungsfestes, wie immer am 23. August, dem „Internationalen Tag zur Erinnerung an den Sklavenhandel und seiner Abschaffung“.2
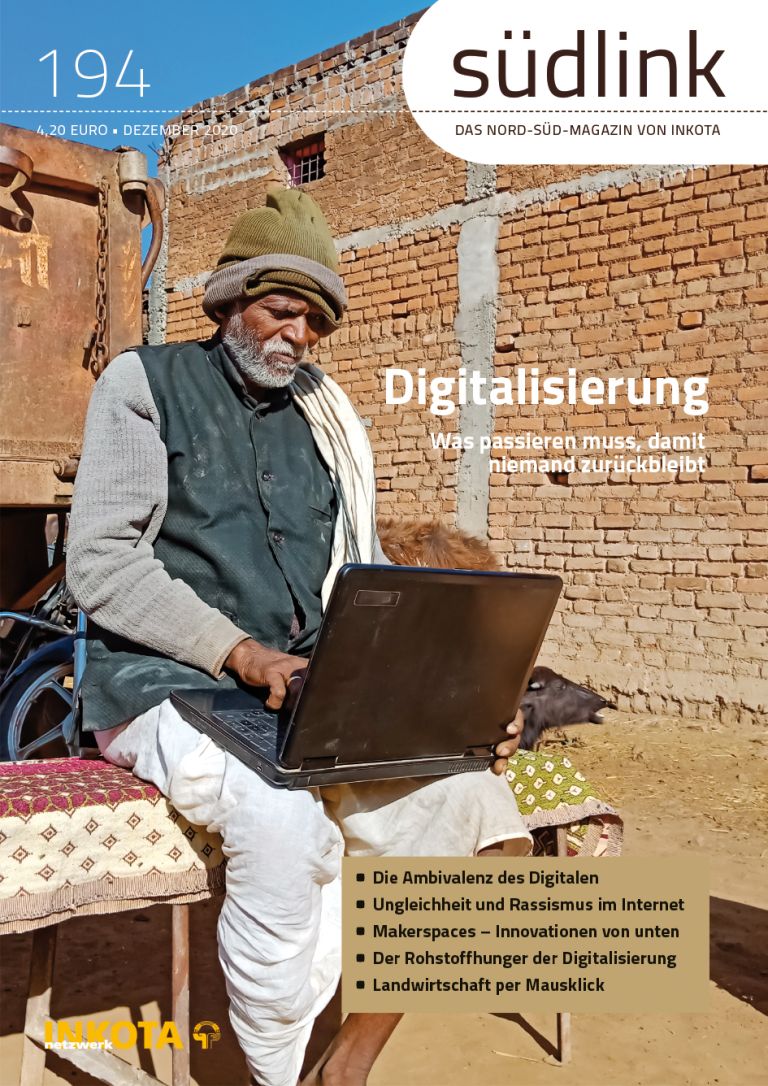
Nachdem sich Wissenschaftler*innen und Studierende des Instituts für Europäische Ethnologie im Rahmen der Nachbarschaftsinitiative Anton-Wilhelm-Amo-Straße im Juni in einem Offenen Brief „Kein Rassismus vor unserer Haustür!“ mit einer langen Liste an Unterstützer*innen für die Umbenennung und das Neudenken der Straße als Ort postkolonialen Zusammenlebens aussprachen, startete Decolonize Berlin am 4. Juli eine Petition zur Umbenennung. Gefühlt gleichzeitig veröffentlichten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) im Kontext der weltweiten Black-Lives-Matter-Proteste überraschend ihre Entscheidung die U-Bahn-Station M*-Straße umzubenennen. Ihren Vorschlag, die Station nach dem russischen Musiker Mikhail Glinka zu benennen, nahm sie nach ersten Protesten wieder zurück. Zum Glück: Der Musiker war ein ausgesprochener Antisemit. Die Umbenennung der U-Bahn-Station steht also noch aus, ist jedoch in Gang.
Auch die Berliner Politik begann sich zu bewegen. Am 18. August beschloss der Berliner Senat, die Umbenennung von Straßen zu vereinfachen und nannte dabei ausdrücklich auch „Straßen, die nach Wegbereitern und Verfechtern von Kolonialismus, Versklavung und rassistischen Ideologien benannt sind oder nach Orten, Ereignissen und Begriffen, die damit im Zusammenhang stehen“. Ein wichtiger Schritt nach vorne. Bereits am 20. August beschloss die Bezirksverordnetenversammlung von Berlin-Mitte die Umbenennung der M*-Straße in Anton-Wilhelm-Amo-Straße; ein Meilenstein, der den Betroffenen der Kolonialgeschichte ein Stück weit Stimme und Teilhabe zurückgibt – und das M*-Straßenfest wenige Tage später zu einem großen Fest des Sieges und der Erinnerung machte. Nun kann die Umbenennung nur noch durch den Widerspruch von Umbenennungsgegner*innen verzögert, aber nicht mehr verhindert werden.
Anton Wilhelm Amo – ein früher Antirassist
Wer aber war Anton Wilhelm Amo eigentlich? Er gilt als erster bekannter Philosoph und Rechtswissenschaftler afrikanischer Herkunft in Deutschland. Als kleiner Junge aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Axim im heutigen Ghana verschleppt und versklavt, wird Amo circa 1707 getauft und wenig später sogenannter Hofm* im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel, wo er dem dortigen Herzog als „Geschenk“ übergeben wurde. Auch wenn Amos Schicksal zunächst durch die Versklavten-Händler der Niederländische Westindien-Kompanie bestimmt wurde, kommt er zu einer Zeit in das Gebiet des heutigen Deutschland, in der das Heilige Römische Reich Deutscher Nation aktiv am Versklavtenhandel beteiligt war. Versklavte Bedienstete afrikanischer Herkunft waren ein Trend an Höfen und galten als Symbole für Macht und Reichtum.
Dies galt auch für Anton Wilhelm Amo. Wenigstens durfte er den vermeintlichen Namen seiner Herkunft (Amo) behalten und genoss eine sehr gute Bildung, die ihm später den Besuch verschiedener Universitäten ermöglichte. Nachdem er 1729 in Halle seine Disputation in Rechtswissenschaft abgelegt hatte, absolvierte er an der Universität Wittenberg seinen Doktor in Philosophie und unterrichtete anschließend in Halle und Jena.
Bemerkenswert an seinem Studium in Halle ist vor allem seine Disputation „De iure Maurorum in Europa“, zu Deutsch in etwa „Über die Rechtsstellung der Schwarzen in Europa“. In seinem leider nur noch in Zusammenfassungen vorhandenen Werk thematisiert Amo, „wie weit den von Christen erkaufften M* in Europa ihre Freyheit oder Dienstbarkeit denen üblichen Rechten nach sich erstrecke.“ Eine solch emanzipatorische und aufgrund ihrer angedeuteten Antiversklavungshaltung implizit antirassistische Arbeit ist für das 18. Jahrhunderts mehr als erstaunlich; einer Zeit des transatlantischen und des arabischen Versklavtenhandels und des sogenannten „wissenschaftlichen“ Rassismus. Während Amo seinen Bildungsweg beschritt und philosophische Werke verfasste, versuchten Wissenschaftler, auch in Deutschland, mit pseudowissenschaftlichen Methoden verschiedene „Rassen“ und deren Unterlegenheit beziehungsweise Überlegenheit zu konstruieren und zu rechtfertigen.
Nicht überraschend finden sich auch Quellen, die Amos Rassismuserfahrungen und Ablehnungen bemerken. Nachdem scheinbar alle zentralen Vertrauten und Unterstützer*innen Amos versterben, verwischt seine Spur allmählich. Überliefert ist lediglich, dass Amo wohl nach einer rassistischen Liebes-Zurückweisung und dem darauffolgenden rassistischen Spott an seinen Geburtsort zurückgekehrt ist. Amo habe seinen Vater und seine Schwester wiedergefunden und Ambitionen gehabt, seinen versklavten Bruder zu befreien, starb wohl jedoch im heutigen Ghana, abseits der Stadt seiner Geburt.
Ja, ich mach mit!
Setzen Sie sich dauerhaft mit uns für eine gerechte Welt ohne Hunger und Armut ein und werden Sie INKOTA-Fördermitglied! Als Mitglied erhalten Sie zudem viermal im Jahr unser Magazin Südlink druckfrisch nach Hause.
Ich bin dabei!Eine Geschichte des Leids und der Hoffnung
Anton Wilhelm Amos Leben bleibt in einigen Punkten ein Mysterium. Es ist kein Geheimnis, dass von Menschen weniger, wenn überhaupt etwas, überliefert wird, wenn sie nicht Teil der politischen Mehrheit sind und sein sollen. Die Tatsache, dass wir Amo selbst und über ihn lesen können und von ihm wissen, ist ein Schatz. Seine Geschichte ist eine von Schmerz, Versklavung, Zwang, Gewalt, Segregation und Anpassung. Aber sie ist auch eine Geschichte von Leben, Kraft und Aufbruch.
Ein Zugehörigkeitsgefühl oder das Gefühl einer Daseinsberechtigung in Deutschland zu empfinden, kann kompliziert sein. Aufgrund seines Aussehens, Namens oder Ursprungs immer wieder infrage gestellt zu werden, wo man herkommt, löst dich von dem Boden, auf dem du stehst. Wir lernen, dass es uns nicht gab. Doch Schwarze Deutsche Geschichte existiert – und zwar länger als seit dem 20. Jahrhundert. Sie existiert, in vielen verschiedenen Formen. Schwarzes Wissen existiert. Schwarze Menschen produzieren Wissen, und das schon immer. Anton Wilhelm Amo war solch ein Mensch, hier in Deutschland.
In einer Welt, die seit jeher versucht Menschen durch ihre Ausbeutung und Auslöschung aus der Geschichte zu radieren, kleinzureden und davon abzuhalten, Wissen und Erinnerung festzuhalten, ist Amo ein wichtiges Symbol für Schwarze Menschen in Deutschland. Er verortet Schwarze Leben und Schwarzes Wissen in Deutschland. Er symbolisiert eine Form der Existenz und des Daseins, die Schwarzen Menschen so in Deutschland meist nicht zuerkannt wird. Schwarzes Leben im heutigen Deutschland ist nicht neu. Amo repräsentiert den Willen nach Recht und Leben und den Anspruch auf Erinnerung und Gedächtnis. Außerdem kann er uns darin bestärken, trotz kollektiver Rassismuserfahrung unsere eigenen Privilegien, wie Bildung, zu erkennen und zu nutzen und unsere Geschichte zu lernen und zu verstehen. Er erinnert an eine Zeit, die unser aller Gegenwart bestimmt, eine Zeit des Leids und der Hoffnung. Diese Erinnerung zu bewahren und die Geschichte nicht zu vergessen, bedeutet auch, die Geschichte weiterzuschreiben.
Angelo Camufingo ist angehender Lehrer, Antirassismus- und Bildungsreferent, Aktivist, Redner und Berater. Seine Arbeit konzentriert sich auf Vielfalt/Diversität, Inklusion, Teilhabe und Bewusstheit.
1 Das M-Wort ist die älteste deutsche Bezeichnung für Schwarze Menschen. Es geht auf das lateinische Wort „maurus“ (‚schwarz‘, ‚dunkel‘, ‚afrikanisch‘) und den altgriechischen Begriff „moros“ („µωρός“: ‚töricht‘, ‚einfältig‘, ‚dumm‘, ‚gottlos‘) zurück. Sein ursprünglicher Entstehungskontext ist die spanische , in der alle Muslim*innen auf der iberischen Halbinsel als „moros“ bezeichnet wurden.
2Der Gedenktag wurde 1998 von der UNESCO beschlossen und wird am 23. August begangen, dem Jahrestag des Beginns des Aufstands versklavter Menschen in Saint-Domingue im Jahr 1791, der 1804 in die Gründung der Republik Haiti mündete. Im weiteren Text benutzen wir den Ausdruck „Versklavte“ statt „Sklaven“. Zum einen, um die Rolle derjenigen hervorzuheben, die andere Menschen versklavt haben, und zum anderen um letztere von der identitär wirkenden Zuschreibung „Sklave“ zu lösen – zugleich ein Widerspruch zu der kolonialrassistischen Annahme, dass jemand „zum Sklaven geboren“ sein könnte.





