
Kolonialer Naturschutz
Die Naturschutzorganisation African Parks verwaltet mittlerweile große Flächen des afrikanischen Kontinents – doch nicht ohne Kritik.
Europa sieht Afrika gerne als ein „Garten Eden“ – einen Kontinent voller unberührter Natur, in dem wilde Tiere mindestens ebenso wichtig sind wie Menschen. Die einflussreiche Nichtregierungsorganisation African Parks setzt alles daran, dieses kolonial geprägte Wunschbild aufrechtzuerhalten. Doch was passiert, wenn Wildtiere wie Wölfe plötzlich in unserer eigenen Umgebung auftauchen?
In Europa lieben wir wilde Tiere – aber nur, solange wir selbst nicht unter ihnen leiden. Nehmen wir den Wolf in Deutschland. Seit der Jahrtausendwende tun die Behörden alles, um die Rückkehr des Raubtiers zu steuern: In Sachsen gibt es eine Fachstelle Wolf, in Brandenburg einen zentralen Ansprechpartner für alle wolfsbezogenen Themen und Thüringen entwickelte bereits 2010 – noch bevor der Wolf in dem Bundesland gesichtet wurde – einen Wolfsaktionsplan. Schäfer in Baden-Württemberg, deren Herden von einem gefräßigen Exemplar angegriffen wurden, können Entschädigungen aus dem Ausgleichsfonds Wolf erhalten. Trotz all dieser Maßnahmen ist die Unterstützung für Wölfe in den letzten Jahren stark gesunken – besonders in Regionen, in denen das Tier am häufigsten vorkommt und für Ärger sorgt.
Auch in anderen Teilen Europas stoßen wachsende Wildtierpopulationen zunehmend auf Widerstand. In den französischen Pyrenäen sorgt der Braunbär für heftige Diskussionen. Besonders eine Gruppe von etwa zehn Bären aus Slowenien, die zur Rettung der lokalen Art ausgesetzt wurden, war lange Zeit Zielscheibe des Unmuts der Einheimischen. Und im dünn besiedelten Schweden vergibt die Regierung jährlich Hunderte Lizenzen zum Abschuss von Bären und Luchsen – angeblich, weil sie eine Gefahr für Vieh, Felder und Menschen darstellen. Die Trophäenjäger freut es, und der schwedische Staat findet: Die Bestände bleiben mit etwa 1.500 Luchsen und 2.500 Bären stabil genug. Proteste anderer EU-Länder blieben aus. Anders läuft es in Afrika. Als Botswana im Jahr 2019 beschloss, jährlich mehreren Hundert wohlhabenden Hobbyjäger*innen eine Lizenz zu erteilen, um einen Elefanten zu erlegen, erzeugte dies weltweit große Empörung. Das Land beherbergt über 130.000 Elefanten – fast jedes dritte Tier Afrikas –, und laut Regierung verursachen die Tiere große Schäden. Sie zerstören oft ganze Ernten – ganz zu schweigen davon, was geschieht, wenn ihre Zahl weiter unkontrolliert wächst.
Daher drohte Botswanas Präsident Mokgweetsi Masisi im vergangenen Jahr, 10.000 Elefanten in den Hyde Park in London zu schicken, damit die Brit*innen selbst erfahren könnten, wie es ist, in der Nähe dieser Tiere zu leben. Deutschland könne sich auch gleich 20.000 Tiere abholen, betonte er. Europäer*innen kümmerten sich mehr um Elefanten als um (afrikanische) Menschen, schloss der botswanische Präsident im Interview. Auch das Nachbarland Namibia hat nach eigenen Angaben mit einem Elefantenüberschuss zu kämpfen. Die Regierung erlaubte kürzlich, 723 Wildtiere zu töten, darunter 83 Elefanten. Das Fleisch war für Einwohner*innen bestimmt, die aufgrund anhaltender Trockenheit zu wenig zu essen haben. Eine frühere Entscheidung, 170 als überzählig geltende Elefanten meistbietend zu verkaufen, hatte – wie in Botswana – internationale Kritik zur Folge.
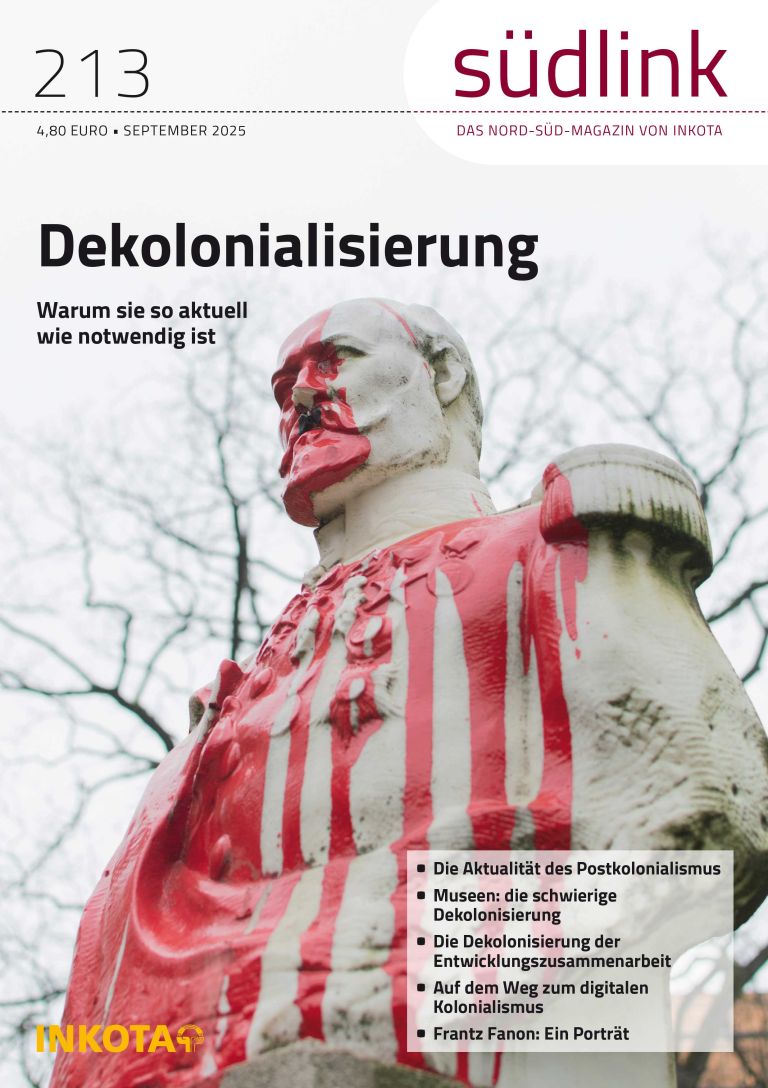
Vorstellung von der „unberührten Wildnis“
Europäische Naturschützer*innen betrachten weite Teile Afrikas als irdisches Paradies, als einen „Garten Eden“, der in Europa verloren gegangen ist. Filme wie „Jenseits von Afrika“ oder „Der König der Löwen“ zeigen endlose Savannen voller Wildtiere. Diese, von Menschen angeblich „unberührte Natur“ soll um jeden Preis geschützt werden.
Die Ironie ist, dass wir unsere Natur in Europa seit der industriellen Revolution weitgehend verspielt haben: Naturschutzgebiete sind oft nicht mehr als kleine grüne Flecken auf der Landkarte, eingeklemmt zwischen Autobahnen und Eisenbahnlinien. In großen Teilen Afrikas haben Flora und Fauna jedoch überlebt – auch wenn großangelegte Jagden und industrielle Ausbeutung von Ressourcen, initiiert durch europäische Kolonialmächte, ebenfalls großen Schaden angerichtet haben.
Eine treibende Kraft hinter dem heutigen Naturschutz in Afrika ist African Parks, eine der mächtigsten Artenschutzorganisationen des Kontinents. In 23 Naturparks in 13 afrikanischen Ländern setzt diese Nichtregierungsorganisation alles daran, Tierpopulationen zu stabilisieren oder geschützte Arten dort wieder einzuführen, wo sie verschwunden sind. In den vergangenen zwanzig Jahren erhielten über 8.000 Tiere, darunter vor allem seltene Nashornarten, Antilopen oder Elefanten, einen neuen Lebensraum.
Die Organisation, 2003 mitbegründet vom niederländischen Unternehmer und Milliardär Paul Fentener van Vlissingen, entwickelte sich zum größten Naturschutzakteur Afrikas. Zunächst operierte sie aus dem Kutscherhaus eines mittelalterlichen Schlosses nahe Utrecht, heute befindet sich der Hauptsitz in einem schicken Geschäftsviertel von Johannesburg in Südafrika. Der 2006 verstorbene Fentener van Vlissingen, der in seiner Freizeit selbst gern Elefanten jagte, bezeichnete die Naturschutzgebiete als „Museen Afrikas“. Die Parks hätten in seinen Augen einen „universellen Wert für die Menschheit“, was sein Engagement rechtfertigte. Kritiker*innen sehen in einem solchen Engagement eher eine Form des Neokolonialismus.
Die Mission von African Parks erscheint auf den ersten Blick als nobel: Wer möchte nicht, dass ikonische Tierarten wie Löwen, Nashörner und Gorillas weiterhin in freier Wildbahn überleben? Berühmtheiten wie Taylor Swift und Leonardo DiCaprio spenden dafür großzügig, und der britische Prinz Harry sitzt sogar im Verwaltungsrat der Organisation. Bei einer großangelegten Umsiedlung von Elefanten in Malawi half er höchstpersönlich mit. Doch die Naturschützer übersehen nicht selten, dass auch in vielen Teilen Afrikas die Bevölkerungsdichte in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen hat. Fast überall auf dem Kontinent sind Naturschutzgebiete von wachsenden Dörfern und Städten umgeben. Und ebenso wie die Deutschen durch den Wolf erleben Menschen in Malawi oder Sambia Belästigungen durch Wildtiere – die oft gefährlicher sind als Wölfe und für deutlich mehr Probleme sorgen. Löwen reißen Vieh, Paviane plündern Ernten, und bei Auseinandersetzungen mit gefährlichen Nilpferden oder Elefanten gibt es jedes Jahr Hunderte von Todesopfern. Zudem geht die Wiederansiedlung verschwundener Arten oder das Wachstum bestehender Populationen in Afrika in der Regel nicht einher mit der Einrichtung, einer Fachstelle Nashorn oder eines Löwenaktionsplans. In Sambia rät man Anwohner*innen, Raubtiere mit einer Vuvuzela zu vertreiben oder einen Zaun aus spitzen Ästen zu errichten. Tiere zu erschießen ist strengstens verboten, wer zuwiderhandelt muss mit hohen Strafen rechnen. Schäden durch vernichtete Ernten oder gerissenes Vieh werden so gut wie nirgendwo ersetzt.
Ja, ich mach mit!
Setzen Sie sich dauerhaft mit uns für eine gerechte Welt ohne Hunger und Armut ein und werden Sie INKOTA-Fördermitglied! Als Mitglied erhalten Sie zudem viermal im Jahr unser Magazin Südlink druckfrisch nach Hause.
Ich bin dabei!Tiere haben mehr Rechte als Menschen
Umgekehrt haben afrikanische Dorfbewohner*innen oft keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu den Naturschutzgebieten, die von African Parks verwaltet werden – obwohl die Anwohner*innen dieses Land als ihr eigenes betrachten. Das gefährdet ihre Existenzgrundlage, da viele für Nahrung und andere Lebensbedürfnisse auf die Ressourcen des Parks angewiesen sind. „Es ist, als hätten Tiere mehr Rechte als Menschen“, so John Mbaria, der kenianische Co-Autor des Buches „The Big Conservation Lie“.
African Parks verfolgt ein Modell des delegierten Managements, bei dem die Organisation in der Regel die vollständige Verantwortung über einen Park von der jeweiligen Regierung übernimmt. Das bedeutet, dass Staaten Kompetenzen wie das Recht auf Festnahme und das Gewaltmonopol abtreten – Befugnisse, die in Europa niemals an private ausländische Organisationen übertragen werden würden. „Ein Staat im Staat“, urteilen Kritiker*innen. Was dieses neokoloniale Bild noch verstärkt: Die Führungsspitze von African Parks besteht vor allem aus weißen Managern – bis vor kurzem war sogar die gesamte Geschäftsleitung weiß.
Auch die Finanzierung kommt von westlichen Regierungen und milliardenschweren Unternehmern. Die Europäische Union fungiert als größter öffentlicher Geldgeber und hat über die Jahre mehr als 150 Millionen Euro an African Parks überwiesen; aus Deutschland kommen Zuwendungen unter anderem von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und dem von der Bundesregierung initiierten Legacy Landscapes Fund. African Parks hat eine eigene Abteilung in Deutschland, die sich unter dem Vorsitz von Dieter Zetsche, der passenderweise Aufsichtsratsvorsitzender des Touristikkonzerns TUI ist, auf die Beschaffung von Finanzmitteln konzentriert.
So bestimmen wir Europäer*innen also nicht nur, wie Naturschutz auf unserem eigenen Kontinent aussieht – wo sich Tiere dem Menschen anpassen müssen. Wir bestimmen auch wesentlich, wie Naturschutz in Afrika ausgestaltet wird – wo sich Menschen möglichst den Wildtieren unterordnen sollen.
Olivier van Beemen ist investigativer Journalist bei der niederländischen Plattform Follow the Money. Er ist Autor von Heineken in Africa: A Multinational Unleashed (2019) und von Im Namen der Tiere (C.H. Beck, 2024), für das er in den Niederlanden mit dem Brusseprijs für das beste journalistische Buch des Jahres ausgezeichnet wurde.
Urheberrecht Bild: Simone Schlindwein




